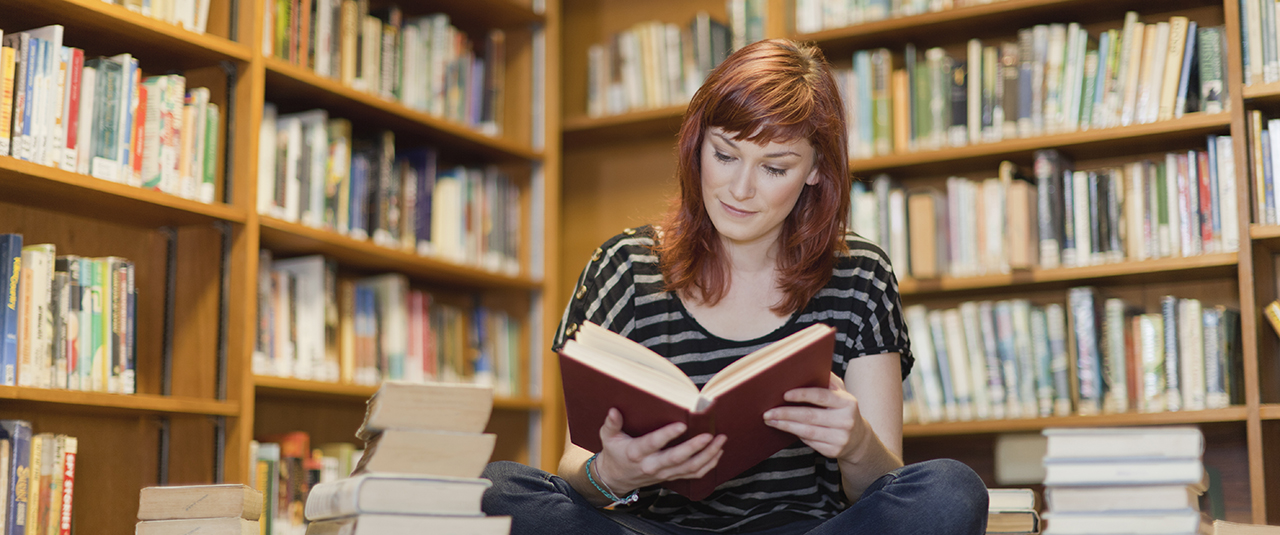
Ausgewählte Krankheitsbilder und Behinderungen Teil 1
In diesem Kapitel stellen wir ausgewählte Diagnosen vor, die häufig im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit stehen. Sie erhalten einen Überblick über die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten sowie weiterführende Informationen. Die nachfolgend beschriebenen angeborenen und erworbenen Erkrankungen, Beeinträchtigungen oder Behinderungen sind nach dem Alphabet sortiert. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf vollständige Darstellung und ersetzen keine fachärztliche Betreuung und Diagnosestellung.
Bei jeder Erkrankung können Notfälle auftreten. In den Modulen „Häusliche Notfälle meistern“ und „Besondere Notfälle meistern“ gibt es dazu weitere Informationen sowie Tipps zur ersten Hilfe.
Ausgewählte Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems
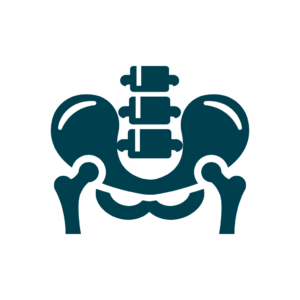
Das Muskel-Skelettsystem besteht aus Knochen, Gelenken und den sie umgebenden Muskeln. Es bildet das Gerüst, das Bewegung ermöglicht.
Erkrankungen am Muskel-Skelettsystem können die Beweglichkeit einschränken, Schmerzen verursachen und die betroffenen Gelenke verdicken bzw. verformen. Viele Krankheitsbilder sind dauerhaft (chronisch) und das Beschwerdebild kann im Verlauf zunehmen.
Mögliche Beschwerden
- Die Beuge- oder Streckbewegung der Arme oder Beine ist beeinträchtigt.
- Der Bewegungsradius eines Gelenks ist eingeschränkt.
- Es kann zu Ruheschmerzen kommen.
- Schmerzen können dazu führen, dass eine Schonhaltung eingenommen wird. Diese kann zwar entlasten, jedoch auch neue Einschränkungen verursachen.
- Ein Gelenk kann anschwellen. Es lässt sich dann weniger gut beugen oder strecken.
- Durch eine Verformung des Gelenks kommt es zu einer Fehlstellung mit Auswirkungen auf die Bewegungsfähigkeit.
- Versteifungen können dauerhaft die Bewegungsfähigkeit eines Gelenks einschränken.

Manche Menschen beschreiben Veränderungen des eigenen Beschwerdebildes im Zusammenhang mit der Wetterlage. Sie sind „wetterfühlig“. Das Phänomen beruht auf einem individuellen Empfinden, eine wissenschaftliche Erklärung gibt es aktuell nicht. Betroffene spüren etwa bei Temperaturschwankungen oder Luftdruckänderungen Gelenk- oder Kopfschmerzen oder leiden unter Schlafstörungen.
Beschwerden am Muskel-Skelettsystem können tagesformabhängig stark schwanken. Ob Beschwerden zu- oder abnehmen, ist auch von den Belastungen des vorherigen Tages abhängig.
Rheumatoide Arthritis - Rheuma
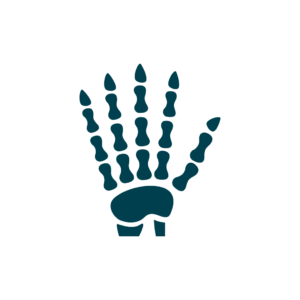
Bei einer rheumatoiden Arthritis verursachen Prozesse im Immunsystem Entzündungen einiger Gelenke. Betroffen sind oftmals die Hand- und Fußgelenke. Auch Gelenkverformungen sind mit der Zeit möglich. Die Krankheit ist chronisch und verläuft in Phasen mit akuten Beschwerden wie Schmerzen, Gelenkschwellungen und Bewegungseinschränkungen sowie Phasen, in denen die Betroffenen recht beweglich sind und kaum Beschwerden verspüren.
Die Rheuma-Liga e. V. hält umfangreiche Informationen für Betroffene und Interessierte bereit.
Die Rheuma-Liga e. V. gibt ebenfalls Tipps, wie Bewegung in den Alltag integriert werden kann.
Arthrose
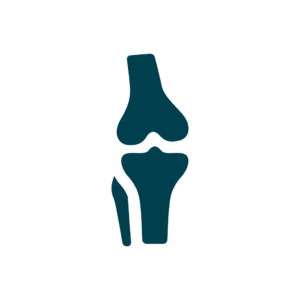
Arthrose ist eine Verschleißerkrankung meist großer Gelenke. Oftmals sind das Knie oder die Hüfte betroffen. Die Erkrankung entsteht durch Abnutzung des Knorpelgewebes. In der Folge schaben die Gelenkflächen gegeneinander und verursachen dabei ggf. Schmerzen, Knacken und Reibegeräusche sowie eine eingeschränkte Beweglichkeit. Typisch sind zudem Schmerzen, die nach einer Bewegungspause auftreten.
Bei einer starken Zunahme der Beschwerden kann eine Operation am Gelenk helfen. Manche Betroffene sind mit einem künstlichen Knie- oder Hüftgelenk versorgt. Sie profitieren im Anschluss von einer verbesserten Beweglichkeit und relativer Beschwerdefreiheit.
Die Webseite der Deutschen Arthrose- Hilfe e. V. hält Informationen für Betroffene und Interessierte zum Thema Arthrose bereit.
Weitere Informationen zur Arthrose gibt das Bundesministerium der Gesundheit auf der Webseite „gesund.bund.de“.
Anhaltende Gelenkbeschwerden sollten fachärztlich begutachtet und behandelt werden.
Was langfristig hilft

Mit gezielten Maßnahmen können Betroffene die Muskulatur stärken, die Gelenkfunktion erhalten bzw. verbessern und so auch die Lebensqualität steigern. Regelmäßige körperliche Bewegung wie Schwimmen, Radfahren oder ein anderes moderates Ausdauertraining helfen, die Beschwerden langfristig abzumildern. Bei Übergewicht kann eine Gewichtsreduktion etwas Druck vom Gelenk nehmen und so auch Schmerzen abmildern.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gibt gezielte Tipps und Anleitungen für Bewegungsangebote, die auch zu Hause durchgeführt werden können.
Was kurzfristig helfen kann

Treten akute Schmerzen auf, ist dies ein Warnsignal. In diesem Fall helfen Bewegungspausen, um das Gelenk zu schonen. Zudem können gezielte Kälte- oder Wärmeanwendungen Schmerzen lindern. In einer solchen Situation ist eine fachärztliche Rücksprache sinnvoll. So kann eine schmerzlindernde medikamentöse Therapie besprochen werden, die für weitere Entlastung sorgen kann.
Eine ärztlich verordnete Physiotherapie unterstützt diese Maßnahmen. Sie kann mit speziellen Übungen zur Stärkung der gelenkumschließenden Muskulatur beitragen.
Asthma bronchiale
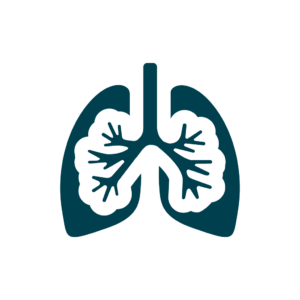
Asthma bronchiale ist eine chronische Erkrankung, welche anfallsartige Atembeschwerden verursacht. Durch verschiedene Reize wie kalte Luft, Pollen oder Staub reagieren die Bronchien (Atemwege) mit einer Schwellung der Schleimhäute. Zugleich steigt die Sekretproduktion. Bei einem akuten Atemnotanfall wird vor allem die Ausatmung schwerer und es bleibt Luft in der Lunge zurück. In der Folge kann weniger sauerstoffreiche Luft einströmen und der Lufthunger wird schlimmer. Typischerweise tritt ein Anfall nachts oder in den frühen Morgenstunden auf.
Einige Beschwerden für einen Atemnotanfall sind hier kurz dargestellt:
- Erschwerte Ausatmung häufig mit Atemgeräuschen
- Trockener und im Verlauf auch produktiver Husten
- Luftnot und eine gesteigerte Atemfrequenz, Kurzatmigkeit
- Starker Einsatz der an der Atmung beteiligten Muskulatur (z. B. ziehen sich die Schultern hoch)
Einen Anfall mitzuerleben, kann beängstigend sein. Für die betroffene Person kann sie mit der Angst zu ersticken einhergehen. Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und der betroffenen Person zu vermitteln, dass der Anfall vorbeigehen wird und sie ihre Notfallmedikamente nutzen kann.
Was kurzfristig helfen kann

- Körperliche Belastung sofort stoppen.
- Eine atemunterstützende Körperhaltung einnehmen, etwa leicht nach vorn gebeugt mit aufgestützten Händen oder Unterarmen, im sogenannten Kutschersitz.
- Zügige Einnahme der Notfallmedikamente wie fachärztlich verordnet (z. B. Dosieraerosol oder Pulver-Inhalator), dabei auf die richtige Vorgehensweise achten.
- Medikamentenwirkung abwarten und in der Wartezeit die betroffene Person nicht allein lassen, ggf. beruhigend mit ihr sprechen.
Was langfristig hilft

Menschen mit Asthma bronchiale erhalten eine fachärztliche Beratung und umfangreiche Informationen zur Therapie. Je nach Beschwerdegrad kann die medikamentöse Therapie angepasst werden. Betroffene lernen, welche Verhaltensweisen das eigene Anfallsrisiko senken und können z. B. Atemübungen erlernen, die vor allem die Ausatmung beruhigen und vertiefen.
Auf der Webseite des Deutschen Allergie- und Asthmabundes e. V. finden Sie unter anderem auch Anleitungen für Atemübungen.
Informationen zu Asthma bronchiale finden Sie auch auf der Webseite der Deutschen Atemwegsliga e. V.
Die Webseite patienten-information.de gibt Tipps für Angehörige und Freunde zum Umgang mit der Erkrankung im Alltag.
Cerebralparese
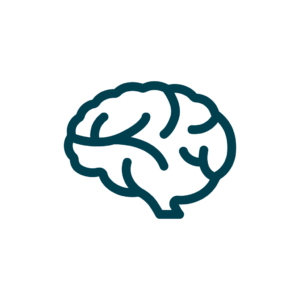
Eine Cerebralparese (CP) wird durch Fehlfunktionen im Gehirn und zentralen Nervensystem (ZNS) verursacht. Sie verändert die Bewegungssteuerung, wirkt auf die Muskelspannung und die Motorik. Hinzu kommen Störungen im Gleichgewicht und bei der Koordination der Bewegungen.
Betroffene haben in den meisten Fällen Bewegungsstörungen, die von Muskelspastiken begleitet sein können (spastische CP). Weitere Symptome können sein:
- Wechselnde Muskelspannung mit unkontrollierbaren Bewegungen
- Muskelzittern
- Einschränkungen im Sehvermögen
- Beeinträchtigung des Hörvermögens
- Epilepsie
Was langfristig unterstützt

Menschen mit einer CP profitieren von einer lebenslangen Betreuung und Behandlung der bei ihnen auftretenden Symptome. Dazu gehören beispielsweise Ergotherapie und eine logopädische Unterstützung bei Sprech- und Schluckproblemen. Die Physiotherapie kann gezielt die Beweglichkeit trainieren und hinsichtlich individueller Bewegungsprobleme unterstützen.
Im Alltag hilft das wiederholte Üben von alltäglichen Bewegungen und Aktionen, um eine gute Lebensqualität zu erlangen und zu erhalten.
Auf der Webseite des Netzwerks Cerebralparese e. V. gibt es weitere Informationen.
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
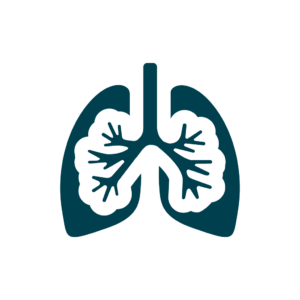
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) entsteht durch eine dauerhafte Schädigung der Bronchien und der Lunge. Verschiedene Faktoren bedingen eine anhaltende Entzündungsreaktion der Bronchien. Ein unangenehmer oftmals produktiver Husten, der nicht nur während eines Infekts auftritt, ist ein Zeichen dieser Entzündung. Im Verlauf der Erkrankung sind Veränderungen an den Lungenbläschen (Alveolen) möglich. Sie können überblähen und dadurch nachhaltig geschädigt werden. Ihre wichtige Funktion für den Gasaustausch können sie dann nicht mehr erfüllen. Man nennt dieses Phänomen Lungenemphysem.
Verschiedene Risikofaktoren können die Entstehung einer COPD begünstigen:
- Rauchen
- Umweltgifte in der Atemluft wie Feinstaub
- Kontakt zu Asbest und anderen Giftstoffen
- Kontakt zu Mehlstaub
Durch die Erkrankung kann die Lunge Sauerstoff unzureichend aufnehmen. Zugleich wird Kohlendioxid nicht mehr in ausreichender Menge abgeatmet. Den Körperzellen fehlt langfristig lebenswichtiger Sauerstoff. Zusätzlich fällt die Atmung schwer, weil die Schleimhäute in den Bronchien anschwellen und die Atemwege verengen. Atemgeräusche und Husten gehören zu den üblichen Symptomen, die unter Belastung auch zunehmen können.
Was den Alltag für die Betroffenen schwierig macht
- Die Betroffenen sind kurzatmig und körperlich wenig belastbar. Beispielsweise strengt das Treppensteigen stark an.
- Tritt ein Infekt auf, verstärken sich die Symptome der COPD. Betroffene entwickeln eine oftmals starke Atemnot. Durch die Sauerstoffnot schnappen sie förmlich nach Luft.
- Zudem verstärkt sich bei einem Infekt der Dauerhusten. Die Hustenanfälle können die Atemnot verstärken.
- Verstärken sich die Symptome der COPD, kann sich das Kohlendioxid im Blut anreichern. Es kommt zu einer Bewusstseinsveränderung. Auch eine Bewusstlosigkeit ist dann möglich.
- Die Zunahme der Atemnot kann eine Erstickungsangst auslösen.
Individuelle Beschwerden lindern

Die Behandlung einer COPD kann die individuellen Beschwerden der erkrankten Person lindern und die Lebensqualität verbessern. Ziel ist auch, ein Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und Atemwegsinfektionen vorzubeugen. Hilfreich ist, Faktoren, die eine COPD begünstigen, zu vermeiden. Dazu gehört etwa, mit dem Rauchen aufzuhören bzw. den Kontakt zu möglichen Risikofaktoren zu minimieren.
In der Behandlung der chronischen Erkrankung profitieren Betroffene von Medikamenten, die atemwegserweiternd wirken und inhaliert werden (z. B. Dosieraerosol). Zur Unterstützung kann die Gabe von Sauerstoff sinnvoll sein. Manche Betroffene benötigen eine zeitweilige Atemunterstützung. Sie nutzen, etwa nachts, ein Beatmungsgerät.
Im späten Stadium einer COPD ist ein unabhängiges Leben kaum möglich. Jede Belastung und sei sie noch so gering, kann zu einer Verstärkung der Atemnot und weiterer Beschwerden führen. Betroffene benötigen deshalb selbst für geringe Anstrengungen, wie den Weg zur Toilette oder zur Körperpflege, Unterstützung.
Eine soziale Teilhabe ist in dieser Situation stark eingeschränkt.
Wie Sie passende Unterstützungsangebote finden können, zeigt die Webseite gesundheitsinformation.de.
Auf der Webseite gesundheitsinformation.de gibt es vertiefende Informationen zum Krankheitsbild COPD.
Depression

Eine Depression beeinflusst das Denken, Fühlen und Handeln. Wer an einer Depression erkrankt, befindet sich in einer anhaltenden gedrückten Stimmungslage. Betroffene geraten beispielsweise in ein dauerhaftes Stimmungstief und können sich daraus allein nicht befreien. Negative Gedankenspiralen und Antriebslosigkeit treten oftmals gemeinsam auf.
Einige weitere Aspekte der Erkrankung sind hier aufgelistet.
- Sich nicht zu einfachen alltäglichen Handlungen aufraffen können (Aufstehen, Körperpflege, Essen und Trinken etc.)
- Rückzug aus Freundschaften
- Beruflicher Rückzug und Leistungsminderung
- Rückzug aus einer Partnerschaft
- Hobbies bereiten keine Freude mehr
- Körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, diffuse Schmerzen, Schlafstörungen
Eine Depression hat unterschiedliche Erscheinungsformen. Einige Aspekte sind hier dargestellt.
Bei einer unipolaren Depression wechseln sich beschwerdefreie Lebensphasen mit Phasen der Depression ab. Beschwerdefreie Lebenszeiten können eine längere Zeit anhalten. Eine depressive Phase kann Wochen bis einige Monate andauern. Die Mehrheit der an Depression Erkrankten lebt mit dieser Form der Erkrankung.
Bei einer bipolaren Depression kommen depressive und manische Lebensphasen vor. In der manischen Phase verspüren Betroffene einen starken Tatendrang. Sie haben ein geringeres Schlafbedürfnis und sind oft ruhelos. Manische und depressive Phasen wechseln manchmal ganz plötzlich.
Hilfe finden bei Depression

Durch eine medikamentöse Therapie können Symptome der Depression wie Hoffnungslosigkeit, Antriebslosigkeit und Freudlosigkeit abklingen. Betroffene können den für sie möglicherweise schwierigen Lebensalltag bewältigen, obwohl sie dies in der depressiven Phase für unmöglich hielten.
Üblicherweise kommen Antidepressiva (sie gehören zu den Psychopharmaka) zum Einsatz. Diese Präparate sorgen für ein „normales“ Befinden – sind weder Beruhigungsmittel noch wirken sie aufputschend.
Eine medikamentöse Therapie benötigt Zeit, da die Wirkung der Präparate verzögert einsetzt und eine Besserung nicht sofort oder innerhalb weniger Stunden oder Tage spürbar sein kann. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene die Arzneimittel zuverlässig und langfristig einnehmen.
Menschen mit einer Depression befinden sich nicht ständig in der oben beschriebenen Situation. Sie wissen meist gut, welche Umstände das Denken, Fühlen und Handeln in eine depressive Phase gleiten lassen können. Sie entwickeln dafür ein Gespür. Therapeutisch begleitet können sie Strategien erlernen, um mit diesen Phasen besser zurecht zu kommen.
- Manche Betroffene profitieren von sportlichen Aktivitäten, wie einem moderaten Ausdauertraining.
- Den Wach-Schlaf-Rhythmus zu verstetigen und Phasen des „länger Liegenbleibens“ zu vermeiden, kann für manche Betroffenen hilfreich sein.
- Sinnvoll ist eine Selbstbeobachtung, um frühe Anzeichen für eine depressive Phase zu identifizieren und diese besser wahrzunehmen.
- Hilfreich kann eine Handlungsanleitung zum Gegensteuern sein, die dann greift, wenn ein Rückfall in eine depressive Phase droht.
Gerade bei psychischen Erkrankungen ist auch für die Angehörigen Unterstützung wichtig. Scheuen Sie sich nicht, Hilfen von Beratungsstellen oder auch Selbsthilfegruppen anzunehmen.
Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention bietet Unterstützung für Angehörige von Menschen mit Depression.
Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e. V. bietet telefonische Beratung und eine Datenbank mit Selbsthilfegruppen an.
Hilfe finden bei Suizidgedanken
Es kann gerade bei dieser Erkrankung vorkommen, dass eine Person Suizidgedanken äußert. Bleiben Sie in diesem Fall ruhig und halten Sie den Kontakt aufrecht. Eventuell benötigt die betroffene Person eine Soforthilfe durch einen Krisendienst oder in einer psychiatrischen Klinik.
Im Modul „Besondere Notfälle meistern“ erhalten Sie vertiefende Informationen für den Umgang mit psychischen Krisen, so auch bei Suizidgedanken.
Was im Alltag helfen kann
Manche Menschen profitieren von Unterstützung im Alltag, wie etwas Hilfe im Haushalt oder für den Einkauf. Hilfreich sind weitere Angebote, die soziale Kontakte aufrechterhalten oder Sport ermöglichen.
Tipps zum Umgang mit depressiv Erkrankten und vielfältige Informationen zu Hilfsangeboten bietet die Deutsche Depressionsliga e. V.
Die Webseite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention hält umfangreiche Informationen zum Krankheitsbild Depression bereit.
Die Barmer informiert auf ihrer Webseite zu Selbstfürsorge und Therapien bei Depression.